


Inhalt:
Bonität wirkt im Hintergrund vieler alltäglicher Entscheidungen, ob bei der Vergabe eines Kredits, der Anmietung einer Wohnung oder dem Abschluss eines Mobilfunkvertrags. Der Kredit-Score bündelt eine Vielzahl einzelner Datenpunkte zu einem statistischen Wahrscheinlichkeitswert, der das Ausfallrisiko abschätzen soll. Zwischen der ökonomischen Notwendigkeit solcher Bewertungen und dem Anspruch auf Datenschutz entsteht ein Spannungsfeld, das nur durch nachvollziehbare Methoden entschärft werden kann.
Transparenz über die Herkunft und Gewichtung der Daten stärkt das Vertrauen in die Aussagekraft des Scores. Gleichzeitig wirft sie Fragen auf, wie genau einzelne Verhaltensweisen im Alltag das eigene Bonitätsprofil formen. Diese Verbindung aus statistischem Modell und persönlicher Lebensführung macht den Score zu einer sensiblen Kennzahl.
Ein Kredit-Score soll die statistische Wahrscheinlichkeit abbilden, mit der eine Person ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Grundlage dafür sind Daten aus unterschiedlichen Quellen, darunter Vertragsabschlüsse, bestehende Kreditverhältnisse, Zahlungshistorien und öffentlich zugängliche Registerinformationen. Diese Daten fließen in mathematische Modelle ein, die mit Hilfe von Vergleichsgruppen und Wahrscheinlichkeitsberechnungen einen numerischen Wert ermitteln. Der sogenannte Basisscore wird meist in Prozent angegeben und reicht bei der Schufa von 0 bis 99,9 Prozent. Er gibt eine allgemeine Einschätzung des Ausfallrisikos über alle Branchen hinweg. Neben diesem allgemeinen Wert existieren weitere Modelle, die speziell auf einzelne Branchen zugeschnitten sind.
Branchenspezifische Scores folgen eigenen Skalen, etwa im Bereich von 100 bis 600 Punkten, und nutzen Gewichtungen, die auf die jeweiligen Geschäftsmodelle abgestimmt sind. So kann ein Score für Banken andere Datenpunkte stärker berücksichtigen als ein Score für den Versandhandel. Manche Werte werden tagesaktuell berechnet, andere in festgelegten Intervallen, etwa quartalsweise, angepasst. Unternehmen nutzen diese Scores als Orientierung, treffen ihre Entscheidungen jedoch eigenständig unter Berücksichtigung zusätzlicher Faktoren. Dadurch kann es vorkommen, dass identische Scorewerte in unterschiedlichen Branchen zu abweichenden Ergebnissen bei der Vertragsvergabe führen.
 Der Basisscore der Schufa wird quartalsweise aktualisiert und dient als allgemeiner Orientierungswert für die Einschätzung der Kreditwürdigkeit. Er berücksichtigt unter anderem die Anzahl und Art bestehender Konten, laufende Kredite, Kreditkarten sowie das Zahlungsverhalten bei Bestellungen auf Rechnung. Auch die Dauer bestehender Vertragsbeziehungen und die Häufigkeit neuer Anfragen fließen in die Berechnung ein. Negativmerkmale wie Mahnbescheide oder titulierte Forderungen wirken sich besonders stark aus, während eine stabile Kontoführung tendenziell positiv bewertet wird. Die zugrunde liegenden Algorithmen gewichten diese Faktoren unterschiedlich, je nachdem, welche statistische Aussagekraft ihnen beigemessen wird.
Der Basisscore der Schufa wird quartalsweise aktualisiert und dient als allgemeiner Orientierungswert für die Einschätzung der Kreditwürdigkeit. Er berücksichtigt unter anderem die Anzahl und Art bestehender Konten, laufende Kredite, Kreditkarten sowie das Zahlungsverhalten bei Bestellungen auf Rechnung. Auch die Dauer bestehender Vertragsbeziehungen und die Häufigkeit neuer Anfragen fließen in die Berechnung ein. Negativmerkmale wie Mahnbescheide oder titulierte Forderungen wirken sich besonders stark aus, während eine stabile Kontoführung tendenziell positiv bewertet wird. Die zugrunde liegenden Algorithmen gewichten diese Faktoren unterschiedlich, je nachdem, welche statistische Aussagekraft ihnen beigemessen wird.
Die Schufa ordnet ihre Scorewerte in Klassen ein, die jeweils eine statistische Ausfallwahrscheinlichkeit abbilden. Hohe Werte deuten auf ein geringes Risiko hin, während niedrige Werte ein höheres Ausfallrisiko signalisieren. In der Praxis nutzen Unternehmen diese Einordnung als Orientierung, ergänzen sie jedoch oft durch eigene Prüfkriterien oder zusätzliche Informationen. Wichtig bleibt, dass ein Score lediglich Wahrscheinlichkeiten ausdrückt und keine Garantie für zukünftiges Zahlungsverhalten liefert. Auch externe Umstände, die nicht im Datenbestand erfasst sind, können das Risiko beeinflussen.
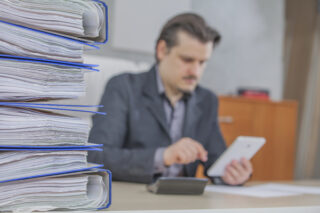 Nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung steht jeder Person einmal pro Jahr eine kostenlose Datenkopie ihrer bei der Schufa gespeicherten Informationen zu. Diese Auskunft enthält neben dem aktuellen Basisscore auch eine Auflistung der gespeicherten Vertragsdaten, Konten, Kredite und eventuellen Negativmerkmale. Zudem wird vermerkt, welche Unternehmen in der Vergangenheit eine Anfrage gestellt haben. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel innerhalb weniger Wochen, wobei die Frist gesetzlich auf maximal einen Monat festgelegt ist. Der Unterschied zu kostenpflichtigen Produkten besteht darin, dass diese oft zusätzliche Darstellungsformen oder laufende Aktualisierungen bieten, während die gesetzliche Datenkopie primär der Transparenz und Kontrolle dient.
Nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung steht jeder Person einmal pro Jahr eine kostenlose Datenkopie ihrer bei der Schufa gespeicherten Informationen zu. Diese Auskunft enthält neben dem aktuellen Basisscore auch eine Auflistung der gespeicherten Vertragsdaten, Konten, Kredite und eventuellen Negativmerkmale. Zudem wird vermerkt, welche Unternehmen in der Vergangenheit eine Anfrage gestellt haben. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel innerhalb weniger Wochen, wobei die Frist gesetzlich auf maximal einen Monat festgelegt ist. Der Unterschied zu kostenpflichtigen Produkten besteht darin, dass diese oft zusätzliche Darstellungsformen oder laufende Aktualisierungen bieten, während die gesetzliche Datenkopie primär der Transparenz und Kontrolle dient.
Sollten in der Auskunft fehlerhafte oder veraltete Angaben erscheinen, besteht ein Anspruch auf Korrektur. In einem solchen Fall empfiehlt es sich, den Sachverhalt schriftlich zu schildern und geeignete Nachweise, etwa Kontoauszüge oder Bestätigungsschreiben, beizufügen. Die Schufa ist verpflichtet, den Vorgang zu prüfen und das Ergebnis zu dokumentieren. Fällt die Entscheidung zu Gunsten der betroffenen Person aus, ist eine zeitnahe Umsetzung der Änderung und ein Vermerk in den Datensätzen nötig. Bei Uneinigkeit besteht zudem die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen und gegebenenfalls eine Schlichtungsstelle oder den Datenschutzbeauftragten einzuschalten.
 CRIF, früher unter dem Namen Bürgel bekannt, zählt zu den größten Auskunfteien in Deutschland und bietet Bonitätsinformationen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Die Datenbasis umfasst sowohl Informationen aus öffentlichen Registern als auch aus direkten Meldungen von Vertragspartnern. Boniversum, ein Unternehmen der Creditreform-Gruppe, arbeitet ähnlich, legt jedoch einen besonderen Schwerpunkt auf den B2C-Bereich, etwa bei Versandhändlern oder Telekommunikationsanbietern. Beide Dienste liefern Scores, die auf branchenspezifischen Gewichtungen beruhen, und ermöglichen so eine passgenaue Risikoeinschätzung.
CRIF, früher unter dem Namen Bürgel bekannt, zählt zu den größten Auskunfteien in Deutschland und bietet Bonitätsinformationen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Die Datenbasis umfasst sowohl Informationen aus öffentlichen Registern als auch aus direkten Meldungen von Vertragspartnern. Boniversum, ein Unternehmen der Creditreform-Gruppe, arbeitet ähnlich, legt jedoch einen besonderen Schwerpunkt auf den B2C-Bereich, etwa bei Versandhändlern oder Telekommunikationsanbietern. Beide Dienste liefern Scores, die auf branchenspezifischen Gewichtungen beruhen, und ermöglichen so eine passgenaue Risikoeinschätzung.
Die infoscore Consumer Data GmbH, heute unter Riverty bzw. Paigo positioniert, ist ein weiterer bedeutender Anbieter im Bonitätssegment. Das Unternehmen liefert Scoring-Services mit einem klaren Fokus auf den E-Commerce, den Versandhandel und Dienstleistungsbranchen. Die Datengrundlage stammt aus eigenen Vertragsbeziehungen, branchenspezifischen Zahlungserfahrungen und teils aus Inkassoverfahren. Im Vergleich zu Schufa oder CRIF liegt der Schwerpunkt stärker auf aktuellen Transaktionsdaten und kurzfristigen Zahlungstrends.
