


Inhalt:
Die elektronische Signatur hat sich in Deutschland fest etabliert. Immer mehr Unternehmen setzen auf digitale Prozesse, um Zeit zu sparen und rechtskonform zu arbeiten. Trotzdem bestehen in vielen Organisationen noch Unsicherheiten bei der Auswahl der passenden Signaturart oder hinsichtlich rechtlicher Details. Deshalb lohnt sich ein aktueller Blick auf die rechtlichen Grundlagen und die verfügbaren Technologien.
Die Grundlage bildet die EU-Verordnung 910/2014 (eIDAS). Sie regelt seit dem 1. Juli 2016 die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste im EU-Binnenmarkt. Seitdem ist die digitale Signatur europaweit rechtsgültig – für Unternehmen, Behörden und Privatpersonen.
In Deutschland gilt seit dem 29. Juli 2017 das eIDAS-Durchführungsgesetz als nationale Umsetzung der EU-Verordnung. Ein zentrales Element darin ist das Vertrauensdienstegesetz (VDG), das die Anforderungen an sogenannte Vertrauensdiensteanbieter (TSPs) festlegt – also etwa Anbieter digitaler Signaturen, Zeitstempel oder Siegel.
Das VDG löste das frühere Signaturgesetz vollständig ab. Es legt fest, welche Organisationen in Deutschland zuständig sind, darunter die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde. Weitere Akteure sind das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS).
Die eIDAS-Verordnung unterscheidet drei Arten elektronischer Signaturen: einfache, fortgeschrittene und qualifizierte. Ergänzend dazu sind auch elektronische Siegel (für juristische Personen) und elektronische Zeitstempel seit 2016 rechtlich anerkannt. Diese Instrumente ermöglichen nicht nur rechtssichere Dokumente, sondern auch revisionssichere Archivierung und Nachvollziehbarkeit von Geschäftsprozessen.
Im Juni 2023 hat die EU-Kommission zudem die Überarbeitung von eIDAS finalisiert und eIDAS 2.0 auf den Weg gebracht. Ziel ist unter anderem die Einführung der EU Digital Identity Wallet, mit der Bürgerinnen und Bürger sich sicher digital ausweisen und signieren können – europaweit.
Eine elektronische Signatur macht ein digitales Dokument rechtlich verbindlich. Sie wird in Form verschlüsselter Daten direkt mit dem Dokument verknüpft. Technisch basiert die Signatur auf einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Dabei kommt ein Schlüsselpaar zum Einsatz – bestehend aus einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel.
Die Person, die unterzeichnet, verwendet den privaten Schlüssel, um die Signatur zu erzeugen. Diese Signatur hängt das System an das jeweilige Dokument an. Empfänger können mithilfe des öffentlichen Schlüssels die Echtheit der Signatur überprüfen.
Solange die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden, schützt die Signatur die Integrität des Dokuments. Sie verhindert Manipulationen und gewährleistet Nachvollziehbarkeit. Wird das signierte Dokument nachträglich verändert, erkennt das System dies sofort. In einem solchen Fall ist eine neue Signatur erforderlich.
Anwender prüfen die Echtheit über den öffentlichen Schlüssel. So stellen sie sicher, dass die Signatur tatsächlich von der angegebenen Person stammt.
Es gibt verschiedene kryptografische Verfahren für digitale Signaturen. Besonders verbreitet ist das RSA-Verfahren, das auf der mathematischen Schwierigkeit der Faktorisierung großer Zahlen basiert. Alternativ kommen auch DSA, ElGamal oder ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) zum Einsatz. Für Unternehmen ist jedoch weniger die Technik entscheidend, sondern die Frage, ob das Verfahren rechtlich anerkannt ist und einen ausreichenden Schutz bietet.
 Die eIDAS-Verordnung erkennt alle drei Signaturarten – einfach, fortgeschritten und qualifiziert – als rechtsgültig an. Sie unterscheiden sich jedoch erheblich in Sicherheitsniveau und rechtlicher Verbindlichkeit. Während einfache Signaturen oft für interne Dokumente ausreichen, ist für Verträge mit externen Partnern häufig eine fortgeschrittene oder qualifizierte Signatur sinnvoll.
Die eIDAS-Verordnung erkennt alle drei Signaturarten – einfach, fortgeschritten und qualifiziert – als rechtsgültig an. Sie unterscheiden sich jedoch erheblich in Sicherheitsniveau und rechtlicher Verbindlichkeit. Während einfache Signaturen oft für interne Dokumente ausreichen, ist für Verträge mit externen Partnern häufig eine fortgeschrittene oder qualifizierte Signatur sinnvoll.
Für viele Unternehmen bietet die einfache elektronische Signatur eine pragmatische Lösung. Sie lässt sich leicht integrieren und ist in vielen Geschäftsprozessen ausreichend. Dennoch erfüllt sie grundlegende Anforderungen an Authentizität und Integrität – sofern der Zugriff gut abgesichert ist.
Technisch verknüpft die Signatur Daten miteinander – beispielsweise den Inhalt eines Dokuments mit einer digitalen Prüfsumme. Hier ein vereinfachtes Fallbeispiel:
Person A erstellt ein Dokument und verwendet ihren privaten Schlüssel, um eine Signatur zu erzeugen. Diese wird kryptografisch an das Dokument angehängt. Der Empfänger nutzt den öffentlichen Schlüssel, um die Signatur zu prüfen. Die Verifikation stellt sicher, dass das Dokument unverändert ist und tatsächlich von Person A stammt. Stimmen die Daten mit dem erwarteten Original überein, gilt die Signatur als gültig.
Digitale Signaturen kommen heute in nahezu allen Branchen zum Einsatz. Sie senken Kosten, beschleunigen Freigabeprozesse und steigern die Zufriedenheit bei Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und Kundinnen und Kunden.
 Ein klassisches Anwendungsfeld ist die Bearbeitung gescannter Papierdokumente. Unternehmen digitalisieren täglich große Mengen an Lieferscheinen, Rechnungen, Verträgen oder Arbeitszeitnachweisen. Diese Dateien werden mit einer digitalen Signatur gesichert, sodass nachträgliche Änderungen sofort auffallen.
Ein klassisches Anwendungsfeld ist die Bearbeitung gescannter Papierdokumente. Unternehmen digitalisieren täglich große Mengen an Lieferscheinen, Rechnungen, Verträgen oder Arbeitszeitnachweisen. Diese Dateien werden mit einer digitalen Signatur gesichert, sodass nachträgliche Änderungen sofort auffallen.
Ein weiterer Vorteil zeigt sich in der Praxis: Digitale Signaturen ermöglichen parallele Freigaben. Mehrere Personen können unabhängig voneinander unterzeichnen. Beteiligte erhalten automatisch eine Einladung und sehen, wer bereits unterschrieben hat – das erhöht die Transparenz und verkürzt Wartezeiten.
Moderne Signaturlösungen lassen sich flexibel an unternehmensspezifische Anforderungen anpassen. Signaturen können direkt im Browser, in E-Mail-Anwendungen oder per App erfolgen – auf Desktops und mobilen Endgeräten. Auch komplexe Szenarien wie Stapelsignaturen, automatische Workflows und rollenbasierte Freigaben sind inzwischen technisch problemlos umsetzbar.
Je nach Bedarf werden Dokumente lokal oder über eine Cloud-Plattform archiviert. Viele Lösungen bieten zudem API-Schnittstellen zur Integration in bestehende ERP- oder DMS-Systeme. Dadurch wird die elektronische Signatur zu einem echten Produktivitätsfaktor.
Die digitale Signatur befindet sich weiter im Wandel. Mit der finalen Verabschiedung von eIDAS 2.0 im Jahr 2024 bringt die EU neue Impulse in den Markt. Ein zentrales Element ist die Einführung der European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet). Mit ihr sollen Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa ihre Identität digital nachweisen, Verträge unterzeichnen und behördliche Services nutzen können – mit einer einheitlichen Lösung auf Smartphone oder Desktop.
Für Unternehmen bedeutet das: Signaturen werden künftig noch einfacher und stärker in zentrale digitale Prozesse integriert. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an IT-Sicherheit, Identitätsprüfung und Benutzerfreundlichkeit. Auch neue Standards wie Remote Signing oder die Verknüpfung mit qualifizierten Attributen (z. B. Beruf, Rolle, Mandat) gewinnen an Bedeutung.
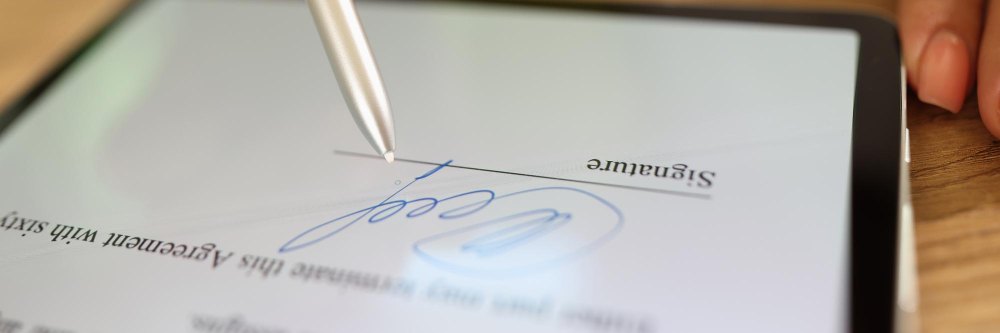
Die elektronische Signatur bleibt ein wichtiger Baustein der digitalen Transformation. Sie steigert die Produktivität, reduziert manuelle Abläufe und stärkt die Rechtssicherheit. Richtig eingesetzt, lassen sich elektronische Signaturen flexibel in bestehende Softwareumgebungen integrieren – von der Vertragsfreigabe über das Rechnungswesen bis hin zur Personalabteilung.
Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen lohnt es sich für Unternehmen mehr denn je, das Thema strategisch zu betrachten und passende Lösungen frühzeitig zu implementieren.