

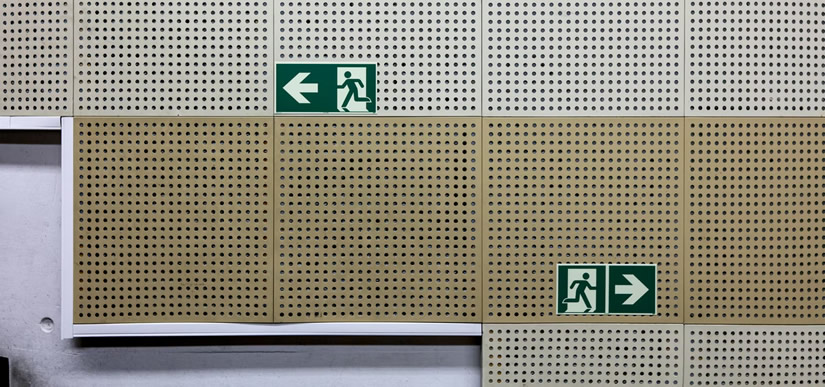
Inhalt:
Das deutsche Gesetz legt einen großen Fokus auf den Schutz von Arbeitnehmern. Wer ein Unternehmen führt, muss die Vorgaben zum Arbeitsschutz, die entsprechende Ausstattung und die Schulung der Mitarbeiter gewährleisten.
Welche Grundlagen gibt es für den Arbeitsschutz, spezifisch für die Sicherheitskennzeichnung des Arbeitsplatzes, und was muss man dabei beachten?
Die gesetzliche Grundlage für den Arbeitsschutz ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Sein Ziel ist es, die Gesundheit aller Beschäftigten zu sichern und zu verbessern.
Auch wenn man beim Arbeitsschutz zunächst an Unternehmen denkt, in denen es spezifische Gefahrenbereiche gibt – wie die Handhabung von Chemikalien – ist er für jedes Unternehmen relevant.
Darunter fallen viele Faktoren; von der Gewährleistung sicherer Fluchtwege bis hin zu gesundheitsfördernden Maßnahmen wie ergonomischen Möbeln und dem Vermitteln von Sportkursen. Vermehrt gehören auch Maßnahmen des Arbeitsschutzes 4.0 zu den Vorgaben, bei denen spezifisch auf die digitale Sicherheit geachtet wird.
Die Gesetze und Verordnungen des Arbeitsschutzes können in mehrere Kategorien unterteilt werden. Die Kennzeichnung des Betriebs ist eine von ihnen. Dabei dreht es sich mitunter um die Auswahl des passenden Verbotsschild für spezifische Gefahrenbereiche, die Planung von Fluchtwegen und die Schulung der Arbeitskräfte.
Sie zählt zu den Arbeitgeberpflichten (§ 3 ArbSchG). Diese besagen:
Die Grundlage für die Kennzeichnung des Betriebs findet man in den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR). In den ASR werden die Gestaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen einschließlich der Gestaltung von Flucht- und Rettungsplänen geregelt.
 Da mit dem Arbeitsschutz auch eine gründliche Unterweisung der Mitarbeiter zusammenhängt, sollte jeder Angestellte das geeignete Wissen haben, um seine Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
Da mit dem Arbeitsschutz auch eine gründliche Unterweisung der Mitarbeiter zusammenhängt, sollte jeder Angestellte das geeignete Wissen haben, um seine Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
Da im stressigen Arbeitsalltag nicht immer die passende Aufmerksamkeit auf alle Einzelheiten von Arbeitsabläufen gegeben ist, dienen die Gefahrenschilder und andere Kennzeichnungen dabei als visuelle Erinnerungen an mögliche Gefahrenquellen.
Insbesondere in Notfallsituationen, die eine Evakuierung des Gebäudes notwendig machen, helfen Dinge wie Fluchtwegmarkierungen dabei, trotz Panik den sicheren Weg zu finden. Zudem sind durch die allgemeingültigen Beschilderungen auch Gäste des Unternehmens in der Lage, auf die Dinge zu achten, in denen reguläre Mitarbeiter geschult sind.
 Bei der Kennzeichnung des Betriebs geht es um die Ausstattung des Arbeitsplatzes mit den entsprechenden Warn- und Verbotsschildern.
Bei der Kennzeichnung des Betriebs geht es um die Ausstattung des Arbeitsplatzes mit den entsprechenden Warn- und Verbotsschildern.
Am Beginn der Kennzeichnung steht eine Gefährdungsbeurteilung, durch die erkannt wird, welche Bereiche auf welche Art gekennzeichnet werden müssen. Diese sollte fortlaufend wiederholt werden, um die Sicherheit des Unternehmens dauerhaft zu gewährleisten.
Zusätzlich sollte man hier auch die Schulung der Mitarbeiter bedenken. Nur, wenn diese wissen, auf welche Gefahr ein Schild hinweist, können sie auch entsprechend reagieren.
In den ASR werden die dazugehörigen Kennzeichnungsarten wie folgt beschrieben:
Zu beachten sind auch Zusatz- und Kombinationszeichen, die an Sicherheitszeichen angebracht sind, um zusätzliche Hinweise zu liefern.
 Die Sicherheitszeichen besitzen meist ein grafisches Symbol, wie einen Pfeil, der die geeignete Handlung beschreibt, und eine Sicherheitsfarbe, der eine spezifische Bedeutung zugeordnet ist. So sind Brandschutzzeichen beispielsweise rot mit weißen Grafiken und/oder Texten und Rettungszeichen grün mit weißen Markierungen.
Die Sicherheitszeichen besitzen meist ein grafisches Symbol, wie einen Pfeil, der die geeignete Handlung beschreibt, und eine Sicherheitsfarbe, der eine spezifische Bedeutung zugeordnet ist. So sind Brandschutzzeichen beispielsweise rot mit weißen Grafiken und/oder Texten und Rettungszeichen grün mit weißen Markierungen.
Weitere, möglicherweise notwendige Sicherheitskennzeichen sind Leucht- und Schallzeichen. Sie ermöglichen das Erkennen von Sicherheitszeichen bei schlechten Lichtverhältnissen und geben Signaltöne, wie eine Sirene, wenn Gefahr besteht.
Auch die verbale Kommunikation und Handzeichen durch Personen sind Teil der Sicherheitsanweisungen.
Bei dem Anbringen der Kennzeichnungen muss ferner die Erkennungsweite bedacht werden. Sie beschreibt den größtmöglichen Abstand, in dem das Sicherheitszeichen noch lesbar und/oder anhand Farbe und Form erkennbar ist.
Die ASR geben mehrere allgemeine Regelungen für die Kennzeichnung von Betrieben vor:
Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ist ein essenzieller Bestandteil des Arbeitsschutzes. Bei ihr ermittelt das Unternehmen durch eine Gefährdungsbeurteilung die notwendigen visuellen und auditiven Kennzeichen, die an Gefahrenbereiche und das richtige Verhalten in Notfällen hinweisen. In den Technischen Regeln für Arbeitsstätten ist genauer festgelegt, welche Arten von Kennzeichen und Abläufen sich für diese Absicherung eignen.