

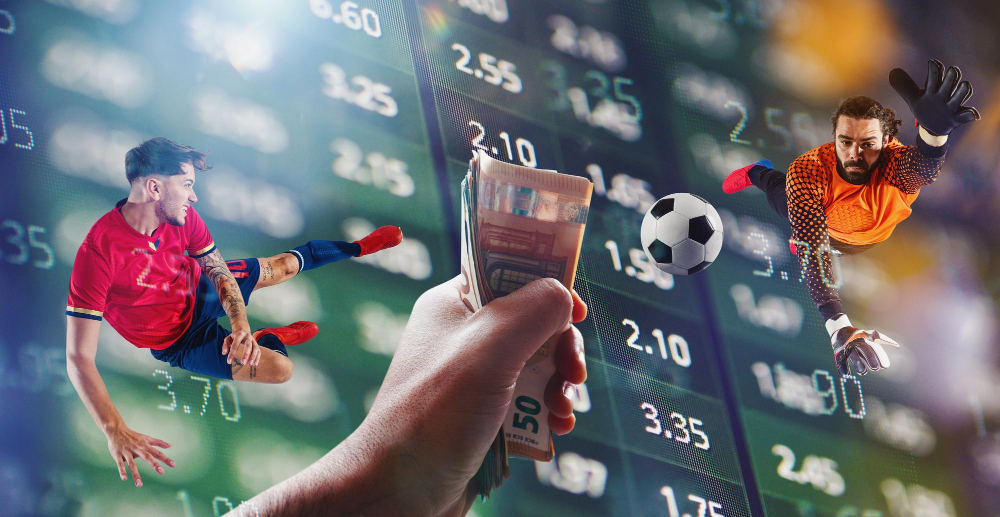
Inhalt:
In Deutschland ist vieles föderal geregelt von der Bildung bis zur Polizei. Doch ein Thema sorgt aktuell für wachsende Spannungen zwischen den Bundesländern: die Verteilung der Steuereinnahmen aus Sportwetten, kurz gesagt die Sportwetten-Steuern. Was auf den ersten Blick wie ein technischer Verwaltungskonflikt wirkt, hat erhebliche finanzielle und politische Tragweite. Hinter der scheinbar trockenen Debatte um Steuersätze und Finanzausgleich verbergen sich konkrete Interessen, angespannte Haushaltslagen und ein komplexes rechtliches Geflecht.
Da jedes Bundesland eigene Prioritäten verfolgt, müssen Zuständigkeiten und Verteilungsschlüssel regelmäßig neu verhandelt werden ein Prozess, der politische Konflikte und strukturelle Spannungen immer wieder neu entflammt.
Deutschland besteht aus 16 Bundesländern mit weitreichender Eigenständigkeit auch im Bereich der Glücksspielregulierung. Grundlage für die bundesweite Gesetzgebung ist der Glücksspielstaatsvertrag, der zuletzt 2021 überarbeitet wurde. Er definiert die Rahmenbedingungen für erlaubte Glücksspielangebote im ganzen Land, lässt den Ländern jedoch Spielraum bei der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung.
Mit dem wachsenden Markt für Sportwetten rücken die finanziellen Interessen der Länder stärker in den Vordergrund. Sportwetten sind längst ein milliardenschweres Geschäft. Seit 2012 fällt in Deutschland eine Steuer von fünf Prozent auf jeden Wetteinsatz an 2021 erweitert um eine 5,3-Prozent-Abgabe auf Online-Spielautomaten und Pokerangebote.
 Die zentrale Frage, die Treffen zwischen Finanzministerien, Gerichtshöfen und Branchenverbänden prägt, lautet: Wer bekommt wie viel vom Kuchen? Und genau daran scheiden sich die Geister.
Die zentrale Frage, die Treffen zwischen Finanzministerien, Gerichtshöfen und Branchenverbänden prägt, lautet: Wer bekommt wie viel vom Kuchen? Und genau daran scheiden sich die Geister.
Während der Bund den rechtlichen Rahmen geschaffen hat, pochen die Länder auf einen größeren Anteil an den Einnahmen schließlich tragen sie auch die Verantwortung für Aufsicht, Spielsuchtprävention und Sportförderung vor Ort.
Doch es geht längst nicht mehr nur um juristische Zuständigkeiten. Angesichts leerer Landeskassen, steigender Ausgaben und wachsender sozialer Herausforderungen wird der Ruf nach einer „gerechteren“ Verteilung der Einnahmen lauter. Länder, die besonders stark in Prävention oder den Breitensport investieren, fordern einen höheren Anteil. Andere wiederum verweisen auf ihre schwierige Haushaltslage ein klassischer Verteilungskonflikt.
 Während sich die Bundesländer streiten, geraten die Sportwettenanbieter zunehmend unter Druck. Viele kritisieren das aktuelle Steuer und Regulierungssystem als wirtschaftlich unattraktiv.
Während sich die Bundesländer streiten, geraten die Sportwettenanbieter zunehmend unter Druck. Viele kritisieren das aktuelle Steuer und Regulierungssystem als wirtschaftlich unattraktiv.
Ein zentrales Problem: Die 5,3-Prozent-Steuer wird auf den Einsatz erhoben unabhängig davon, ob der Anbieter am Ende überhaupt einen Gewinn erzielt. Das schmälert die Margen erheblich und macht den Markt für legale Anbieter unattraktiver.
2022 zogen alle 33 damals lizenzierten Anbieter gemeinsam gegen das Land Hessen vor Gericht. Sie klagten über überzogene Auflagen, wirtschaftlich fragwürdige Regeln und eine Benachteiligung seriöser Anbieter, auch durch die Sportwetten-Steuern. Verbände wie der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) fordern seitdem eine Besteuerung auf Basis des Bruttospielertrags also jenes Betrags, der nach Ausschüttung der Gewinne tatsächlich beim Anbieter verbleibt.
 Seit Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags im Jahr 2021 verzeichnet der regulierte Markt rückläufige Zahlen. So sanken die getätigten Wetteinsätze 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent.
Seit Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags im Jahr 2021 verzeichnet der regulierte Markt rückläufige Zahlen. So sanken die getätigten Wetteinsätze 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent.
Diese Entwicklung schürt die Sorge, dass überregulierte Märkte und hohe Steuerlasten die Spieler zurück in den grauen oder illegalen Markt treiben könnten mit entsprechenden Folgen für Steuereinnahmen und Verbraucherschutz.
Für die Bundesländer bedeutet das: Weniger Einnahmen und ein härter geführter Verteilungskampf.
Es stellt sich die Frage, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist. Wäre es nicht sinnvoller, den legalen Markt durch gezielte Anreize attraktiver zu gestalten stabil, sicher und wirtschaftlich tragfähig?
Ein überregulierter Markt könnte das Gegenteil dessen bewirken, was eigentlich beabsichtigt ist: Statt für Markttransparenz, Verbraucherschutz und staatliche Kontrolle zu sorgen, verlieren legale Angebote an Attraktivität und der illegale Markt gewinnt an Boden.

Auch wenn Gerichte bislang den bestehenden Steuerrahmen gestützt haben, bleibt die eigentliche Frage offen: Wie lässt sich eine faire, nachhaltige und bundesweit tragfähige Lösung finden, die wirtschaftlichen Realitäten gerecht wird und gleichzeitig politische sowie soziale Ziele nicht aus dem Blick verliert?
Eine einfache Antwort gibt es nicht doch genau deshalb könnte dieser Konflikt der nötige Anstoß für eine tiefgreifende Reform sein.