

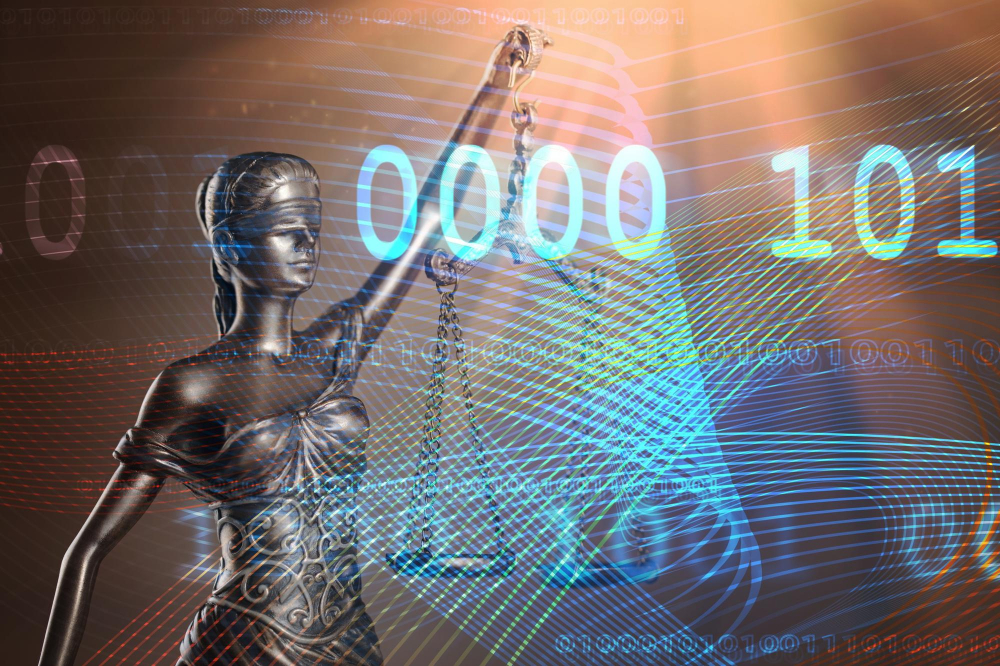
Regulierungen gelten vielen als Bremse für Innovation. Doch im digitalen Umfeld von 2025 zeigt sich ein anderes Bild: Neue Regeln wirken zunehmend als Motor für Wettbewerb und Transparenz. Ob bei Kryptowährungen, im Zahlungsverkehr oder in den App-Märkten – überall entstehen neue Anbieter, während etablierte Unternehmen ihre Strategien anpassen müssen. Der Sommer 2025 markiert eine Phase, in der Verbraucher erstmals konkret spüren, wie Regulierung den Alltag verändern kann.
Kaum ein Bereich betrifft den Alltag so direkt wie das Bezahlen. Ob beim Online-Shopping, an der Supermarktkasse oder beim Überweisen unter Freunden – Zahlungen müssen schnell, sicher und unkompliziert funktionieren. Genau hier setzt die Reform des europäischen Zahlungsverkehrs an. Mit der neuen Richtlinie PSD3 und den bereits verpflichtenden Instant-Payment-Regeln ab Januar 2025 verändert sich der Markt spürbar: FinTechs wittern ihre Chance, Banken stehen unter Druck – und Verbraucher gewinnen an Komfort und Transparenz.
Der Rat der EU hat im Juni 2025 ein Verhandlungsmandat verabschiedet, die Umsetzung wird jedoch erst 2026 erwartet. Dennoch wirken die Reformen schon jetzt: Parallel wurde die Verordnung zu Echtzeitzahlungen beschlossen, die seit Januar 2025 gilt. Banken müssen seitdem Instant-Überweisungen empfangen; das zugrunde liegende SCT-Inst-Schema sieht eine Maximaldauer von zehn Sekunden vor. Ab Oktober 2025 wird auch das Senden verpflichtend.
Diese Neuerung verändert den Markt sichtbar. FinTechs nutzen die Chance, günstige Dienste rund um Echtzeitüberweisungen aufzubauen. Klassische Banken, die lange auf Überweisungsfristen setzten, modernisieren ihre Infrastruktur, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Ein Beispiel ist die ING Deutschland, die bereits im August 2025 den europäischen Bezahldienst Wero direkt in ihre App integriert hat. Damit entsteht eine Konkurrenz zu etablierten Playern wie PayPal oder Klarna. Für die Nutzer bedeutet das mehr Komfort und weniger Kosten – ein direkter Vorteil durch Regulierung.
Ein weiteres Feld, in dem Regulierung neue Dynamik schafft, ist der Digital Markets Act. Er verpflichtet große Plattformbetreiber wie Apple und Google, fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Lange Zeit hatten diese Konzerne durch geschlossene Ökosysteme den Marktzugang für kleinere Anbieter erschwert. Doch seit 2023 sind sie offiziell als Gatekeeper eingestuft – und müssen seither Anpassungen vornehmen.
Im Sommer 2025 zeigt sich, wie ernst es die EU meint. Apple führte im App Store ein neues Gebührenmodell ein: Entwickler können ihre Apps günstiger einstellen, wenn sie auf bestimmte Services verzichten, oder zahlen höhere Gebühren für ein Rundum-Paket. Zugleich dürfen sie Nutzer nun direkt auf externe Kaufoptionen hinweisen. Google senkte im August 2025 seine Provisionen für App-Erstkäufe drastisch und erlaubt ebenfalls externe Links. Diese Änderungen sind keine freiwilligen Gesten, sondern Reaktionen auf laufende Verfahren nach dem DMA.

Von den neuen Regeln profitieren nicht nur klassische App-Entwickler, sondern auch ganze Branchen: Streaming-Anbieter können ihre Dienste mit mehr Preismodellen direkt an Nutzer verkaufen, ohne hohe Margen an die Store-Betreiber abzuführen. Sichtbar ist die Veränderung auch im iGaming-Sektor: Apple ließ Real-Money-Gaming-Apps bereits zuvor zu. Neu unter dem DMA sind nun vor allem Steering-Rechte und zusätzliche Vertriebs- sowie Zahlungswege – auch für iGaming-Anbieter, sofern sie national reguliert sind und unabhängig davon, ob diese etabliert oder frisch auf dem Markt sind.
Für die Verbraucher bedeutet das eine spürbare Öffnung: mehr Auswahl an Entertainment-Apps, flexiblere Zahlungsoptionen und die Möglichkeit, Streaming- oder Gaming-Dienste direkt über alternative Wege zu abonnieren. Damit erfüllt der DMA genau seinen Zweck – er bricht geschlossene Strukturen auf und schafft einen digitaleren Binnenmarkt, in dem Innovation und Wettbewerb wieder Platz finden.
Die EU-Verordnung Markets in Crypto-Assets ist seit dem 30. Dezember 2024 voll anwendbar. Ihr Ziel: Einheitliche Regeln für Krypto-Dienstleister, die bislang unter einem Flickenteppich nationaler Vorgaben agierten. Anbieter von Stablecoins und Handelsplattformen müssen seitdem eine Lizenz als „Crypto-Asset Service Provider“ beantragen oder als Bank ihre Tätigkeit anzeigen.

Die Folgen zeigen sich deutlich: Innerhalb von sechs Monaten wurden in der EU mehr als vierzig neue Anbieter registriert, dazu über ein Dutzend Emittenten von Stablecoins. Gleichzeitig erhielten große Banken wie die spanische BBVA erstmals die Genehmigung, Krypto-Dienste anzubieten. Für Start-ups bedeutet MiCA, dass sie mit klaren Spielregeln Vertrauen gewinnen können. Für große ist die Regulierung dagegen ein Stresstest: Nur wer Transparenz über Eigenkapital und Sicherheiten schafft, bleibt langfristig im Markt. Für Verbraucher entsteht so ein sichereres Ökosystem, das dubiose Anbieter zunehmend verdrängt.
Während neue Start-ups die Chance nutzen, den Markt zu betreten, sind auch die etablierten Anbieter gefordert. Banken wie die ING oder die Sparkassen investieren massiv in Instant-Payment-Infrastrukturen. Große Krypto-Börsen richten ihre Compliance-Teams neu aus, um MiCA-konform zu arbeiten. Und Tech-Konzerne wie Apple und Google passen ihre Geschäftsmodelle unter europäischem Druck an.
Das zeigt: Regulierung führt nicht zwangsläufig zu Rückzug oder Stagnation. Stattdessen zwingt sie die „alten Hasen“, flexibler zu werden und den Kunden entgegenzukommen. Für die digitale Gesellschaft bedeutet das, dass bewährte Dienste erhalten bleiben, aber zugleich neue Alternativen entstehen. Es ist ein Nebeneinander von Stabilität und Innovation, das im Sommer 2025 den digitalen Alltag prägt.
