

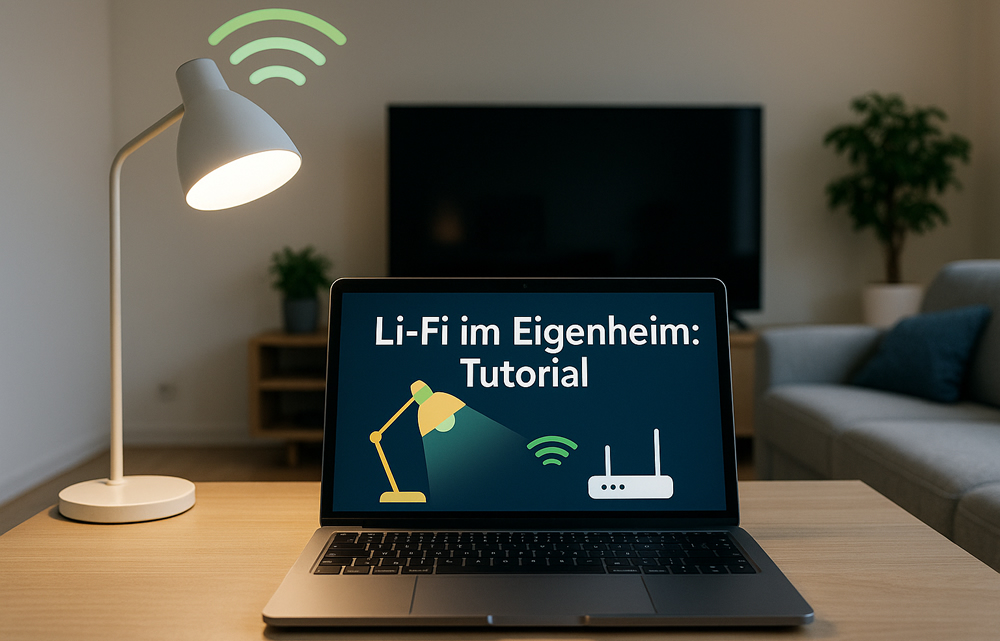
Inhalt:
Unsichtbare Technologien durchziehen längst jeden Raum. Wo einst Kabelsalat lag, funken heute Router und Repeater still ihre Signale durch Wände und Decken. Der Klang einer modernen Wohnung bleibt leise, weil Datenströme keine Geräusche hinterlassen. Dennoch ruht darauf eine stille Selbstverständlichkeit, fast ein Anspruch: Immer soll das Netz verfügbar sein, möglichst unmerklich, immer in Reichweite.
Doch herkömmliches WLAN stößt an Grenzen, die sich erst dann zeigen, wenn große Datenmengen blitzschnell wandern sollen oder das letzte Zimmer am Flur plötzlich im Funkloch verschwindet. Neue Bedürfnisse wachsen heran, weil Videos in hoher Auflösung, Smarthome-Systeme und vernetzte Arbeitsplätze andere Anforderungen stellen. Hier rückt Li-Fi ins Bild – eine Technik, die Daten über Licht überträgt und dabei oft unbemerkt bleibt.
Li-Fi nutzt sichtbares Licht, um Daten zu übertragen. Dabei flackern LEDs in so hoher Frequenz, dass das menschliche Auge nichts bemerkt. Über feine Modulationen gelangen Informationen von einer Lampe zu einem Empfänger – ähnlich wie beim WLAN, nur dass hier keine Funkwellen, sondern Lichtstrahlen arbeiten. Während WLAN breit gestreute Radiowellen einsetzt, die sich durch Wände und Möbel kämpfen, bleibt Li-Fi auf Sichtverbindungen angewiesen. Das klingt zunächst nach Einschränkung, eröffnet jedoch zugleich neue Möglichkeiten, weil Licht sich sehr präzise lenken lässt und dabei kaum störanfällig ist.
Diese Technik bringt einige bemerkenswerte Vorteile mit. Zum einen erreicht Li-Fi theoretisch Datenraten, die deutlich über denen klassischer Funknetze liegen. Zudem bleibt der Übertragungsbereich klar begrenzt, weil Licht nicht durch Wände dringt. So entsteht eine Art natürliche Zugriffsbeschränkung, die das Abfangen von Signalen erschwert. Außerdem stört Li-Fi keine medizinischen Geräte und lässt sich sogar dort einsetzen, wo Funktechnologien unerwünscht sind – etwa in Flugzeugen oder Krankenhäusern.
 Ein Li-Fi-System stellt ein Heimnetz vor etwas andere Anforderungen als herkömmliches WLAN. Die Technik lebt vom Licht, daher braucht sie LED-Leuchten, die Daten übertragen können. Solche Lampen dienen nicht nur als Lichtquelle, sondern gleichzeitig als Sender. Auf der Gegenseite arbeiten kleine Fotodetektoren, oft in Form spezieller USB-Dongles oder Chips im Endgerät, die die Lichtimpulse empfangen und in Daten umwandeln. Damit das funktioniert, muss eine direkte Sichtverbindung bestehen. Möbel oder Wände schirmen das Signal vollständig ab. Wer also mit Li-Fi experimentieren will, sollte zunächst prüfen, wo sich geeignete Leuchten anbringen lassen und ob sich der Raum mit direkter Lichtachse nutzen lässt.
Ein Li-Fi-System stellt ein Heimnetz vor etwas andere Anforderungen als herkömmliches WLAN. Die Technik lebt vom Licht, daher braucht sie LED-Leuchten, die Daten übertragen können. Solche Lampen dienen nicht nur als Lichtquelle, sondern gleichzeitig als Sender. Auf der Gegenseite arbeiten kleine Fotodetektoren, oft in Form spezieller USB-Dongles oder Chips im Endgerät, die die Lichtimpulse empfangen und in Daten umwandeln. Damit das funktioniert, muss eine direkte Sichtverbindung bestehen. Möbel oder Wände schirmen das Signal vollständig ab. Wer also mit Li-Fi experimentieren will, sollte zunächst prüfen, wo sich geeignete Leuchten anbringen lassen und ob sich der Raum mit direkter Lichtachse nutzen lässt.
Manche Wohnsituationen bringen jedoch Hürden mit sich. Große Schränke, Raumteiler oder verwinkelte Grundrisse können den Lichtweg unterbrechen. Auch Vorhänge, Pflanzen oder andere Deko-Elemente werfen Schatten, die das Signal brechen. Materialien mit stark reflektierenden oder sehr dunklen Oberflächen beeinflussen unter Umständen die Lichtausbreitung. Deshalb lohnt es sich, vor dem Einbau zu überlegen, welche Räume tatsächlich für Li-Fi taugen und ob gegebenenfalls kleine Umbauten helfen, eine störungsfreie Strecke zu schaffen.
 Für ein funktionierendes Li-Fi-Heimnetz braucht es zunächst einige spezielle Bausteine. Im Zentrum stehen LED-Leuchten, die mit einem Modulator ausgerüstet sind und damit nicht nur Licht spenden, sondern gleichzeitig Datenpakete senden. Dazu kommen Empfänger, oft kleine USB-Dongles oder ins Gerät integrierte Fotodetektoren, die die Lichtsignale lesen. Außerdem wird meist ein Controller oder Hub benötigt, der die Daten vom Router an die Li-Fi-Leuchte weitergibt und so die Verbindung ins Internet herstellt. Manche Systeme setzen zusätzlich auf ein Software-Interface, das Einstellungen wie Bandbreitenzuweisung oder Geräteverwaltung erlaubt. Die Installation verläuft in mehreren Schritten.
Für ein funktionierendes Li-Fi-Heimnetz braucht es zunächst einige spezielle Bausteine. Im Zentrum stehen LED-Leuchten, die mit einem Modulator ausgerüstet sind und damit nicht nur Licht spenden, sondern gleichzeitig Datenpakete senden. Dazu kommen Empfänger, oft kleine USB-Dongles oder ins Gerät integrierte Fotodetektoren, die die Lichtsignale lesen. Außerdem wird meist ein Controller oder Hub benötigt, der die Daten vom Router an die Li-Fi-Leuchte weitergibt und so die Verbindung ins Internet herstellt. Manche Systeme setzen zusätzlich auf ein Software-Interface, das Einstellungen wie Bandbreitenzuweisung oder Geräteverwaltung erlaubt. Die Installation verläuft in mehreren Schritten.
Zuerst wird die Li-Fi-Leuchte an die Stromversorgung angeschlossen und mit dem heimischen Netzwerk verbunden, häufig per Ethernet-Kabel oder über einen zentralen Hub. Danach kommen die Empfänger ins Spiel, die per USB oder direkt im Gerät installiert werden. Sobald alles verbunden ist, lässt sich die Verbindung in der jeweiligen Netzwerkliste auswählen. Manchmal erfordert es ein kleines Software-Setup, um Treiber zu installieren oder die Schnittstelle zu konfigurieren. Danach läuft der Datentransfer fast so unauffällig wie bei WLAN – nur dass hier das Licht den Takt vorgibt.
 Im Alltag zeigt sich rasch, dass Li-Fi anders funktioniert als herkömmliche Funklösungen. Die Bewegungsfreiheit bleibt zwar erhalten, solange sich der Empfänger im Lichtkegel befindet. Doch Schatten, Möbel oder sogar eine unachtsam abgestellte Tasche können das Signal abrupt unterbrechen. Wer durch den Raum läuft, muss sich darauf einstellen, dass Datenströme reißen, sobald der direkte Lichtkontakt fehlt. Außerdem endet die Reichweite dort, wo der Lichtschein endet – anders als WLAN, das selbst durch mehrere Wände noch schwaches Signal liefert.
Im Alltag zeigt sich rasch, dass Li-Fi anders funktioniert als herkömmliche Funklösungen. Die Bewegungsfreiheit bleibt zwar erhalten, solange sich der Empfänger im Lichtkegel befindet. Doch Schatten, Möbel oder sogar eine unachtsam abgestellte Tasche können das Signal abrupt unterbrechen. Wer durch den Raum läuft, muss sich darauf einstellen, dass Datenströme reißen, sobald der direkte Lichtkontakt fehlt. Außerdem endet die Reichweite dort, wo der Lichtschein endet – anders als WLAN, das selbst durch mehrere Wände noch schwaches Signal liefert.
Vergleicht man Li-Fi mit WLAN oder Powerline, treten die Eigenheiten deutlich hervor. Während Powerline-Datenströme über Stromleitungen reisen und WLAN Funkwellen nutzt, braucht Li-Fi stets freie Sicht. Dafür punktet es mit hoher Geschwindigkeit und geringerer Anfälligkeit für elektromagnetische Störungen. Gerade in sensiblen Umgebungen oder wo absolute Trennung von Netzen gefragt ist, kann das ein Vorteil sein.
